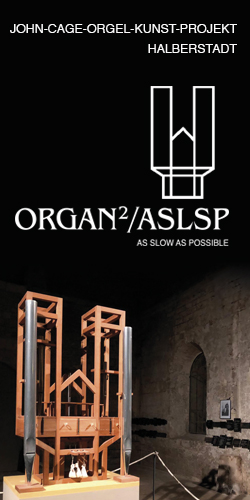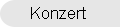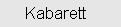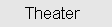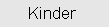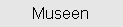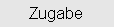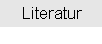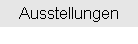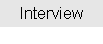Im Monat April verändern sich die abendlichen Beobachtungsbedingungen abrupt. Der natürliche Faktor ist dabei die Verschiebung der Dämmerung und die damit verbundene Zunahme der Tageslänge. Bis zum Ende des Monats nimmt sie auf 14 Stunden und 40 Minuten zu. Ein zweiter, in diesem Falle selbst auferlegter Faktor stellt die Umstellung auf die Sommerzeit dar. Von einem Tag auf den anderen verschiebt sich dadurch die Dämmerung um eine weitere Stunde. Daher ist das Aufsuchen der Sternbilder auf Zeiten nach 20 Uhr beschränkt. Trotzdem ist der Wechsel von den Wintersternbildern zu den Frühlingssternbildern deutlich auszumachen. Der Löwe mit seinem Hauptstern Regulus und die ab Mitternacht sichtbare Jungfrau mit ihrem Hauptstern Spica bestimmen den Anblick in südlicher Richtung. Die Planeten machen sich nun komplett rar. Während Jupiter kurz nach der Sonne untergeht, kommen Mars, Saturn und Venus kaum zur Geltung, da sie flach am Osthimmel stehen. Bereits kurz vor Sonnenaufgang werden sie vom Morgenrot überstrahlt.
Die aktuellen Missionen zu unserem Erdtrabanten sind aufgrund ihrer vielfältigen Ziele und der inzwischen auch privat finanzierten Unternehmungen nicht leicht überschaubar.
Schauen wir zunächst rückblickend auf vergangene Jahre: Im April 2019 stürzte der private israelische Mondlander Beresheet-1 bei seinem Landeversuch ab und im April 2023 schlug der ebenfalls private japanische Mondlander Hakuto-R auf unserem Erdtrabanten unsanft auf.
Recht unrühmlich endete auch der erste Versuch der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos nach 47 Jahren wieder eine wissenschaftliche Mission zu unserem Erdbegleiter zu unternehmen, denn am 20.August zerschellte die russische Raumsonde Luna 25 auf der Mondoberfläche. Die vorhergehende Mission Luna 24 landete übrigens fast punktgenau am 18.8.1976 im Mare Crisium, nur wenige hundert Meter vom Landeort der Vorgängersonde Luna 23 entfernt. Es war die letzte erfolgreiche sowjetische Mondmission, die sogar Proben von der Oberfläche mit Hilfe einer Rückkehrsonde zur Erde brachte. Die 170 Gramm Mondgestein wurden mit Hilfe eines Bohrgerätes aus einer Tiefe von zwei Metern gewonnen.
Warum nun so viele Jahre später nicht einmal mehr die sanfte Landung glückte, lässt viel Raum für Spekulationen. Es scheint, dass die Konzentration der russischen Ingenieure auf das Kerngeschäft des Transports von Kosmonauten zur Internationalen Raumstation ISS keine Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Techniken aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zuließ. So scheiterte die eigentlich als das russische Jubiläums-Vorzeigeobjekt konzipierte Luna 25-Mission kläglich.
Dagegen feierte nur drei Tage später, am 23.8.23 Indien die erfolgreiche Landung seiner Sonde Chandrayaan-3. Das indische Raumfahrzeug landete sanft am Südpol des Mondes. Dort hofft man an Kraterrändern, in die aufgrund der hohen südlichen Lage kein Sonnenlicht gelangt, auf Wasser zu stoßen.
Den Start zur diesjährigen Mond-Kampagne bildete mit der Raumsonde Peregrine eine private Mission der US-Firma Astrobotic. Aufgrund eines Treibstofflecks bekam die Sonde bereits Probleme beim Start und verglühte in der Erdatmosphäre. Ein herber Rückschlag für das ambitionierte Team der in Pittsburgh ansässigen Firma.
Erfolgreicher war Mondlandemission IM-1 des privaten Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines. Die Mondsonde Odysseus konnte weich landen, kippte aber wenig später um. Nach dem Ende der Mondnacht am 20.März will man versuchen „Odie“, wie die Missionleitung liebevoll das Landemodul nennt, zu reaktivieren.
Die Mission SLIM der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA brachte am 19.Januar eine Mondlandefähre in der Nähe des Kraters Shioli im Mare Nectaris zur Landung. Allerdings musste die Sonde dann in einen Tiefschlaf versetzt werden, um alle Energiereserven in der mit bis zu Minus 160 Grad bitterkalten Mondnacht zu speichern. Die Berechnungen für den „Auftauprozess“ sahen zunächst nicht gut aus, doch dann wurde bald klar, dass der Lander die Mondnacht überraschend gut überstanden hat. Die Bilder stammen übrigens von einem kleinen technischen Meisterwerk. Es ist eine wenige Zentimeter große Minisonde, die sich kurz nach der Landung entfaltete und über den Sender des Mutterschiffs die einzigartigen Daten übertrug.
Die Hintergründe für die erneuten Versuche des Menschen, auf dem Mond Fuß zu fassen liegen klar auf der Hand: Zum einen ist der Mond von großem Interesse, da man Bodenschätze wie Seltene Erden, die für die E-Mobilität auf unserem Planeten so wichtig sind, im großen Stil abbauen will. Zum anderen ergibt sich für die erdzugewandte Seite des Mondes die ideale Möglichkeit einer Startbasis für den Flug zum Mars. Die Vorteile für den Start einer Marsmission sind durch die geringe Schwerkraft begründet. Ein Raumschiff, das für eine mehrjährige Reise von mindestens vier Marsionauten konzipiert wäre, könnte sich aufgrund der gewaltigen Größe nur sehr schwer aus der Erdumlaufbahn heraus zum roten Planeten beschleunigen. Auf der „Moonbase“ könnte es hingegen Modul für Modul zusammengebaut werden, bevor es zu der rund zweijährigen Reise zum Mars startet.
Zuvor allerdings muss man gewissermaßen das Fahrrad noch einmal neu erfinden. Mit dem Artemis-Programm versucht dies die NASA schon seit mehreren Jahren. Nach dem erfolgreichen Test der unbemannten Mondmission "Artemis 1“ Ende 2022 sollte nun im November 2024 der erste bemannte Flug erfolgen: Mit Artemis 2 fliegt die Menschheit wieder zum Mond und diesmal steht mit der Missionsspezialistin Christina Hammock Koch erstmals eine Frau vor dem Flug zu unserem Erdtrabanten. Zur Crew der Artemis 2 gehören weiterhin der Kommandant Reid Wiseman, der Pilot Victor Glover sowie Missionsspezialist Jeremy Hansen.
Anfang des Jahres gab allerdings die NASA bekannt, dass der Start aufgrund technischer Probleme in den September 2025 verschoben werden muss. Seit der letzten Mondmission durch die Besatzung der Apollo 17 sind übrigens 52 Jahre vergangen. Aber nur durch diese Schritte, die unweigerlich an die Abläufe der Apollo Missionen vor mehr als 50 Jahren erinnern, wird es gelingen, eines Tages eine funktionierende Mondbasis aufzubauen.
Skurriel mutet dabei die Auftragsvergabe für die neu zu entwickelnde Mondlandefähre an: Zwei private Firmen sind mit diesem hochsensiblen Projekt betraut worden. Zum einen die Firma Blue Origin des Milliardärs Jeff Bezos, die ihr Projekt „Blue Moon“ bereits relativ weit voran getrieben.
Zum anderen ist natürlich auch Elon Musk mit seiner Firma Space X dabei. Gigantische 47 Meter hoch soll das Landegerät werden, was für die ohnehin problematische Landung auf unserem Erdtrabanten viel zu groß zu sein scheint. Doch hier wird erst die ferne Zukunft zeigen, wer diesen Wettlauf zum Mond gewinnen wird. Interessant ist allerdings der Fakt, dass die NASA für die Entwicklung dieser konkurrierenden Mondlander genau festgelegte Fördersummen verteilt. Experten gehen aber davon aus, dass die hochtechnisierten Projekte mindestens doppelt so teuer werden, sodass die ohnehin nicht zu den Ärmsten zählenden Chefs Bezos und Musk etliche Milliarden aus der eigenen Tasche in die Entwicklung stecken werden. Schon jetzt sind Unsummen für die Fortentwicklung der Projekte angesetzt. Aber für die Befriedigung ihres eigenen Egos ist den beiden Superreichen scheinbar nichts zu teuer und das wiederum ist der Hintergrund des seit Jahren anhaltenden Duells um die Spitzenposition in der Raumfahrt der Zukunft.
Abschließend gibt es einen Grund zum Schmunzeln, denn noch immer wird die B-Variante des ersten Marsbesuches diskutiert. Die Idee: Mit einem „One Way Ticket“ sollen die ersten Marsionauten ausgestattet sein, denn ein Rückflug zur Erde ist bei dieser Variante der Mission nicht geplant. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich tatsächlich einige Freiwillige bei der NASA gemeldet. Sie wären dann die ersten Erdenbürger, die auf einem anderen Planeten ihre letzte Ruhestätte erhalten würden – ein letztlich recht abstruser Gedanke.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt