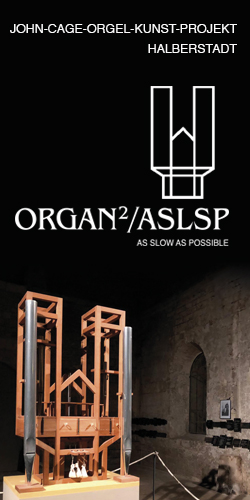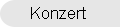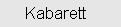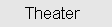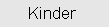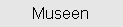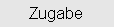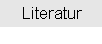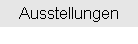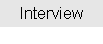Im Monat Oktober merken wir nun deutlich, dass die Tage wieder kürzer werden.
Am 23. September hatten wir Tagundnachtgleiche. Zugleich ist dies der astronomische Herbstanfang und der Einstieg in das Winterhalbjahr. Auch am Sternhimmel vollzieht sich ein deutlicher Wandel und wir können am frühen Abend die verschiedensten Konstellationen bewundern. So sind im Südwesten mit den Sternbildern Leier, Adler und Schwan noch die Sternbilder des Sommerdreiecks gut zu erkennen. Im Süden wiederum steht das aus Andromeda und Pegasus bestehende Herbstviereck sichtbar in mittlerer Höhe. Aber auch die ersten Wintersternbilder schauen am frühen Morgen in nordöstlicher Richtung über den Horizont. Allen voran der Fuhrmann mit seinem leuchtend hellen Stern Kapella, seines Zeichens dritthellster Stern am Nordhimmel.In der morgendlichen Dämmerung ist sogar der hellste der nächtlichen Sterne gut zu erkennen. Es ist Sirius aus dem Sternbild Großer Hund. Allerdings zeigt sich hier deutlich, wie stark die Planeten das Sonnenlicht reflektieren, denn in südlicher Richtung überstrahlt der Planetengigant Jupiter deutlich das Licht des Sterns Sirius. Wenn man dann auch noch gute Sicht in Richtung Osten hat, fällt der Planet Venus als „Morgenstern“ sofort ins Auge. Seine Helligkeit stellt alle anderen Himmelsobjekte in den Schatten.
Vor gut 40 Jahren begann mit der Entdeckung des Planeten 51 Pegasi b auf einer nachweisbaren Umlaufbahn um den Katalogstern 51 im Sternbild Pegasus das Zeitalter eines neuen Forschungsgebietes der Astronomie: Das Aufspüren von fernen Exoplaneten. Seither sind mehr als 5300 dieser extrasolaren Himmelskörper identifiziert worden. Die meisten von ihnen gerieten natürlich aufgrund ihres großen Abstandes zu ihrer Exosonne und ihrer gigantischen Größe recht bald in die Fänge der Detektoren der Exoplaneten-Jäger. Es sind die sogenannten „Super Jupiters“, die zum Teil den bis zu zehnfachen Durchmesser unseres Planetenriesen Jupiter aufweisen. (https://www.nasa.gov/topics/universe/features/super-jupiter.html)
Doch die Suche sollte sich schon bald auf die Planeten konzentrieren, die ihren Hauptstern auf einer engeren, der Erde ähnlichen Bahn umlaufen. Sie wird habitable Zone genannt und in unserem Planetensystem hat nur die Erde diese ideale Position inne. Selbst unser Nachbarplanet Mars liegt am äußersten Rand dieses Areals. Es ist somit nur eine schmale Zone, in der sich Lebensformen nach Ansicht der Astronomen entwickeln können. Nur hier ist der optimale Abstand zum wärmenden Stern gegeben und die Möglichkeit der Existenz von Wasser unter einer Atmosphäre, die außerdem noch vor den gefährlichen Strahlungsarten des Zentralsterns schützt, vorhanden.
Doch leider ist es in erster Linie genau die relative Nähe zum Hauptstern, die einen Nachweis sehr schwierig macht. Mit der Zeit aber haben die Astronomen ihre Beobachtungsmethoden verfeinert und so konnte nun erstmals eine Gruppe von Forschern um Nikku Madhusudhan von der Universität Cambridge vermelden, dass der Planet K 2 -18b tatsächlich eine Atmosphäre besitzt und dass die Temperaturen annehmbar sind. Natürlich konnte dies nur mit dem derzeit stärksten Auge der Menschheit, dem James-Webb-Space-Telescope, nachgewiesen werden. Die Astrophysiker haben kohlenstoffhaltige Moleküle wie Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18b nachgewiesen. Außerdem ist dort Dimethylsulfid (DMS) vorhanden, ein Molekül, das zumindest auf der Erde nur von Lebewesen produziert wird. Die weitere Auswertung der Daten verspricht also spannend zu werden.
Mit der Entdeckung ist logischerweise noch keine intelligente Lebensform nachgewiesen, denn die DMS-Spuren deuten eher auf einfachere Bioformen hin. Doch wie wäre es, wenn jemand dort draußen im Abstand von 120 Lichtjahren ganz in der Nähe des Braunen Zwergstern K 2-18 im Sternbild Löwe mit uns Kontakt aufnehmen wollte? Dies wäre ein aufwendiger Prozess, denn aufgrund der Lichtgeschwindigkeit würde eine einzige simple Kommunikation mit Frage und Antwort allein schon 240 Jahre dauern.
Wie schaut es aber mit einem direkten Besuch unserer eventuellen neuen Nachbarn aus? Gelinde gesagt sind unsere derzeit erreichbaren kosmischen Geschwindigkeiten dafür viel zu gering und mit der vielzitierten Schneckenpost vergleichbar. Das derzeit schnellste, von Menschenhand gebaute Raumschiff ist die Parker Probe Sonde. Nach einer letzten Kurskorrektur soll sie mit fast 700.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne rasen. Zum Vergleich: Mit dieser Geschwindigkeit würde man von Berlin startend New York in etwa 33 Sekunden erreichen.
Mit 61.500 Kilometern pro Stunde ist die Raumsonde Voyager 1 mehr als zehn Mal langsamer, dafür verlässt sie aber unser Sonnensystem. Da eine Kurskorrektur nach 46 Jahren Flugdauer nicht mehr möglich ist, könnte es nur der Zufall in die Nähe des Planeten K 2-18b bringen. Doch die Reisezeit ist mit mehreren Hunderttausend Jahren unfassbar lang und stellt darüber hinaus nur den Hinflug dar. Allerdings kommt noch ein weiterer, nicht außer Acht zu lassender Fakt dazu: Voyager 1 ist weder für eine Landung noch für ein Abbremsmanöver gebaut. Für ein gesichertes „Abfangen“ müsste direkt vor Ort die außerirdische Lebensform selbst sorgen. Diesen Gedanken griff der berühmte Astronom Carl Sagan bereits bei der Konstruktion der Raumfahrzeuge Voyager 1 und 2 auf, indem er die vergoldeten Laser Discs an die Raumfahrzeuge anbringen ließ.
Er ging davon aus, dass eine Lebensform, die dieses Gefährt entdeckt, so intelligent sein sollte, die Raumsonde abzufangen und zu bergen. Dann sollte es für die extraterrestrischen Wesen ein Leichtes sein, auch ein Abspielgerät für die „Goldene Schallplatte“ zu entwickeln, um dann die dort gespeicherten Informationen über die Spezies Mensch abzurufen. Sagan hat dereinst natürlich nur grundsätzliche Informationen über die Bewohner des dritten Planeten des Sterns Sonne auf die Scheibe bringen lassen. Hätte er auch erwähnt, dass die Geschichte der Menschheit in erster Linie durch Kriege bestimmt wurde und dass sich daran leider bis heute nur wenig geändert hat, würde das Interesse der Außerirdischen an den wohl doch nicht so intelligenten Menschen vom Planeten Erde sicher recht schnell verblassen.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt