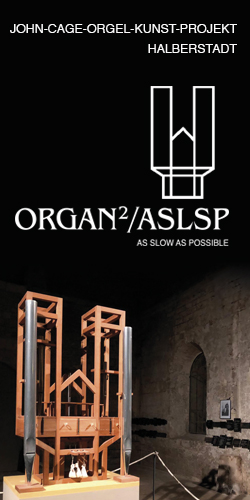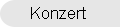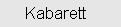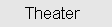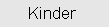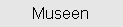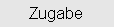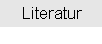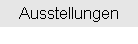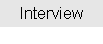Im März drängen sich zwar gleich mehrere Planeten kurz vor Sonnenaufgang im Osten, bequem beobachtbar sind sie jedoch nicht. Man müsste schon als Frühaufsteher gegen 5 Uhr unterwegs sein, dabei einen möglichst wolkenfreien Morgenhimmel erwischen und dann noch völlig freie Sicht in Richtung Nordosten haben, um den grandiosen Anblick der Planetenparade zu erhaschen. Kurz nacheinander gehen Venus, Mars und Saturn auf und sind bis zum Einbruch der astronomischen Dämmerung bis gegen 6 Uhr in knapp 10 Grad Höhe zu erspähen.
Langsam aber sicher wird das Sternbild Löwe die Wintersternbilder als Frühlingsbote ablösen. Trotzdem kann man zu recht angenehmen Beobachtungszeiten zwischen 19.30 und 22 Uhr vor allem den Himmelsjäger Orion, seine ihn begleitenden Hunde und die flankierenden Sternbilder Zwillinge und Stier bewundern. Hoch über allen steht der Fuhrmann.
Am 18. März haben wir den letzten Wintervollmond. Da unsere Sonne am 20.3. um 16.33 Uhr den Frühlingspunkt durchläuft, verschiebt sich der Ostertermin auf Mitte April nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der 20.3. ist somit der astronomische Frühlinganfang und gleichzeitig die erste Tagundnachtgleiche des Jahres. Ende des Monats beginnen dann die Tage wieder etwas länger zu werden als die Nächte.
Die Sonne und ihre Aktivitätserscheinungen geben den Forschern noch immer große Rätsel auf, denn noch sind einige Zusammenhänge im Spiel der atmosphärische Kräfte unseres Sterns im Fokus der Forschung. Sicher wird hier die Parker Probe Sonde der NASA neue Erkenntnisse liefern. Noch muss man sich dabei etwas gedulden, denn die eigentliche Hauptmission wird erst beginnen, wenn die Sonde ab Mitte des Jahres mit einem Abstand von 15 Millionen Kilometer viermal näher als der Planet Merkur an unserem Zentralgestirn vorbeifliegt und die Instrumente bei Temperaturen um 1500°C einwandfrei arbeiten.
Auf der Erde ist neben den verschiedenen Strahlungsarten des elektromagnetischen Spektrums vor allem der permanente Strom hochenergetischer Teilchen direkt nachvollziehbar. Es ist der sogenannte Sonnenwind, der unablässig von der Sonnenoberfläche in den Raum abgestrahlt wird. Nur ein verschwindend geringer Teil erreicht dabei die 150 Millionen Kilometer entfernte Erde.
Eine Grundvoraussetzung des Lebens auf unserem Planeten ist das starke Magnetfeld, das uns vor dem gefährlichen Sonnenwind schützt. Ob bei einem Weltraumaufenthalt eines ISS-Astronauten oder bei den Mondexkursionen der Amerikaner vor über 50 Jahren: Der gefährliche Teilchenstrom der Sonne prasselt mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Sekunde auf den Raumanzug. Hat dieser nur eine geringfügige Fehlfunktion im Bereich des Strahlenschutzes, ist das Risiko für den Weltraumforscher extrem hoch. Dies wird die Forschungsarbeit zukünftiger „Marsionauten“ entscheidend beeinflussen. Möglicherweise sind sie bei einem verstärkten Sonnensturm für Tage an ihre Unterkunft gefesselt.
Seit vor über 130 Jahren dem deutschen Astronomen Martin Brendel am 5. Januar 1892 erste Fotos von einem Polarlicht gelang, rankten sich um diese Nordlichter die verschiedenartigsten Geschichten. Man sprach sogar von „Erschröcklichen Wunderzeichen“ und konnte das Himmelsschauspiel kaum richtig einordnen.
Erst mit Hilfe der modernen Forschung erkannte man, dass es ein chemisch-physikalisches Phänomen der Hochatmosphäre ist. Die Teilchen des Sonnenwindes werden durch den Dipoleffekt des Erdmagnetfeldes in Richtung der Pole geleitet. Dort interagieren sie in ca. 100 km Höhe mit den Stickstoff- und Sauerstoffatomen der Hochatmosphäre. Die äußerst heftige Reaktion lässt dann für viele Minuten und manchmal sogar Stunden das unfassbar schöne Polarlicht entstehen. Die Fachwelt unterscheidet dabei die nördliche Aurora borealis (Nordlicht) und die südliche Aurora australis (Südlicht). Sie sind besonders gut während der Polarnacht zu bewundern.
Waren die ersten fotografischen Dokumentationen dieser Erscheinung noch recht dürftig, so sind heute viele astronomisch interessierte Amateurfotografen alljährlich auf der Jagd nach dem besten Foto. Ausgestattet mit professionellem Equipment gelingen ihnen zum Teil großartige Aufnahmen. Wer diese bewundern möchte, dem seien der Internetauftritt von „The World at Night“ oder die deutschsprachige Website Seite von „Astronomy Picture oft the Day“ empfohlen. Die teilweise riesige Ausbreitung dieser ungewöhnlichen Naturerscheinung lässt sich am besten mit dem Blick von der ISS nachvollziehen (https://www.youtube.com/watch?v=kG3CjOphSuo).
Natürlich ist das persönliche Erlebnis eines Polarlichtes durch nichts zu ersetzen, doch leider bleiben nicht nur für den Autor sondern auch für viele andere Menschen solche Augenblicke aufgrund der doch recht aufwendigen Reiseplanung und der ungewöhnlichen Urlaubszeit meist nur ferne Träume.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt