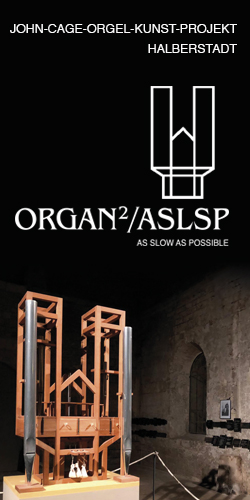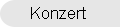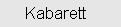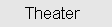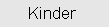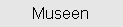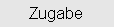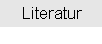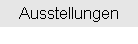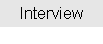Gleich zu Beginn des Monats stehen Jupiter und Venus sehr nah beieinander. Diese enge Begegnung ist recht selten und nicht von Dauer. Schon zur Monatsmitte wird sich Jupiter immer mehr von der Venus entfernen, um dann Ende des Monats ganz vom Abendhimmel zu verschwinden. Er steht dann hinter der Sonne, geht somit gemeinsam mit ihr auf und unter und ist so für uns nicht sichtbar.
Venus hingegen wird mehr und mehr zum hellsten Objekt nach dem Mond und zeigt sich von seiner besten Seite als Abendstern. Gegen Ende des Monats ist sie mehr als zwei Stunden nach Sonnenuntergang noch deutlich zu erkennen. Der Planet Mars ist dagegen schon recht blass und befindet sich oberhalb des Sternbildes Zwillinge.
Die Wintersternbilder verabschieden sich langsam von der Himmelsbühne, denn am 21. März haben wir die erste Tagundnachtgleiche des Jahres. Die Beobachtungszeiten werden dann durch die immer länger werdenden Tage auch immer kürzer und so gehen die Konstellationen gegen 22 Uhr unter. Als letzte Sternbilder des Winters bleiben die Zwillinge und der Fuhrmann aufgrund ihres höheren Standes noch bis nach Mitternacht am Himmel.
Erst nach und nach wird das Frühlingssternbild Löwe mit seinem Hauptstern Regulus den Anblick des gestirnten Himmels in Blickrichtung Süden bestimmen. Gegen 23 Uhr erreicht es seine beste Sichtbarkeit in dieser Himmelsrichtung.
Die Kleinkörper des Sonnensystems unterteilen sich in fünf Gruppen, wobei die Klasse der interstellaren Himmelskörper erst vor wenigen Jahren durch die Entdeckung von Omuamua überhaupt entstanden ist.
Ein zweiter Himmelskörper dieser Art, benannt nach seinem Entdecker Borisov, zog im Jahr 2019 mit 175.000 Stundenkilometern rasend schnell an der Sonne vorbei, um sich danach wieder in die unendlichen Weiten des interstellaren Raumes zu verabschieden. Wahrscheinlich hat er aber diesen Gewaltritt um unser Zentralgestirn nicht schadlos überstanden, denn Aufnahmen des Hubble-Space-Telescope geben Grund zu der Annahme, dass der ca.15 Kilometer große Körper in zwei Teile zerbrochen ist.
Die Gruppe der Zwergplaneten wird von Pluto, dem ehemals neunten der Planeten des Sonnensystems, angeführt. Gerade einmal fünf Zwergplaneten gehören zu dieser im Jahr 2006 ins Leben gerufenen Klasse von Himmelskörpern mit einem Durchmesser von mehr als 1000 km, welche sich auf eigenständigen Keplerbahnen um unser Zentralgestirn bewegen (siehe Kosmos 88 und Kosmos 95).
Die drei klassischen Gruppen der Kleinkörper stellen die Meteoriten, die Kometen und die Asteroiden dar. Viele Menschen haben im Verlauf ihres Lebens durch die Beobachtung einer Sternschnuppe (astronomisch: Meteor) den letzten, extrem hellen Moment eines sehr kleinen Körpers des Sonnensystems miterlebt. In Sekundenbruchteilen verdampft dabei das eisigkalte Material des Meteoroiden, welches zuvor über mindestens 4,6 Milliarden Jahre existiert hat. Vereinzelt können sie aber den Eintritt in die Erdatmosphäre überstehen und sind dann als Meteoriten auffindbar (siehe Kosmos 78).
Dagegen ist das Erlebnis einer Kometenbeobachtung mit bloßem Auge recht selten. Im vergangenen Monat gab es für den Kometen C/2022 E3 (ZTF) kurzzeiteig die Möglichkeit des Aufsuchens am Nachthimmel, doch nur bei guter Sicht und mit einem lichtstarken Fernglas konnte die grünliche Kometenkoma erkannt werden.
Derzeit stehen allerdings die Asteroiden im Fokus der astronomischen Forschung, denn gleich eine ganze Armada von Raumsonden untersuchte sie in den vergangenen Jahrzehnten. Teilweise haben diese Raumflugkörper auch direkte Untersuchungen vor Ort durchgeführt.
Den Anfang machte 1991 die Galileo-Sonde auf ihrem Weg zum Jupiter. Im Vorbeiflug machte sie Aufnahmen des Asteroiden (243) Ida und (951) Gaspra.
Mitte der neunziger Jahre machte NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) Bilder von (253) Mathilde, um fünf Jahre später sogar auf (433) Eros.
Der japanischen Hayabusa-Mission gelang dann 2005 erstmalig sogar die Entnahme von Bodenproben auf (25143) Itokawa. Nach erfolgreicher Landung der Rückkehrkapsel in Australien konnten wenige Gramm Oberflächenmaterial sichergestellt werden. Wesentlich mehr Material soll die Sonde OsirisRex 2018 auf (101955) Bennu aufgesammelt haben. Gespannt wartet man auf den 24.September dieses Jahres, denn zu diesem Zeitpunkt wird die Rückkehrkapsel auf der Erde erwartet.
Für viel Zündstoff sorgte im letzten Jahr die Mission DART (Double Asteroid Redirection Test). Erstmals gab es einen gezielten Einschlag auf dem Himmelskörper Dimorphos, der den rund doppelt so großen Asteroiden (65803) Didymos wie ein Mond umrundet. Das Experiment gelang hervorragend, denn die rund zwölfstündige Umlaufzeit von Dimorphos verkürzte sich um eine halbe Stunde.
Die Frage nach dem „Warum?“ beantwortet sich recht schnell, denn der Reaktionstest war der erste erfolgreiche Versuch einen Körper des Sonnensystems in seiner Bahn zu stören. Darauf wird es ankommen, wenn eines Tages tatsächlich ein Asteroid der Erde bedrohlich nahe kommt. Eine Zerstörung des Asteroiden, wie in dem mit viel Aufwand produzierten Hollywood-Film „Armageddon“ dargestellt, ist keineswegs sinnvoll, denn die Streuung der Trümmer würde die Bedrohung für die Erdoberfläche noch erheblich erhöhen. Was man braucht ist - wie man so schön sagt - ein kleiner Schubs, damit das Objekt einfach einen anderen Weg einnimmt und die Erde schlicht und ergreifend nur passiert. Das ist natürlich kein Stoff für einen Sensationsfilm, doch gleichzeitig ist es der erste Schritt bei der Erprobung von Methoden der planetaren Verteidigung.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt