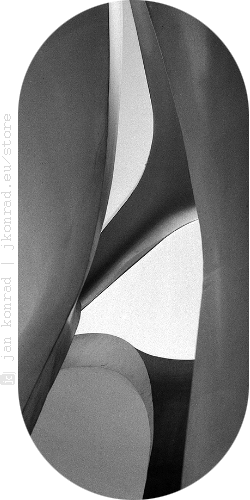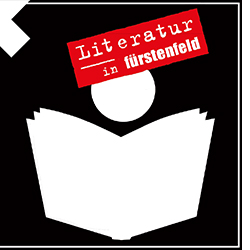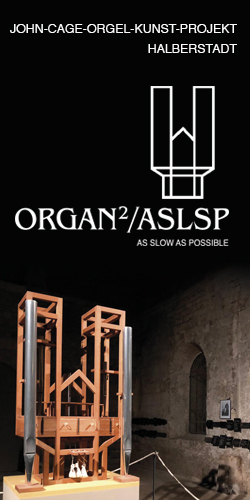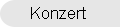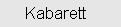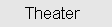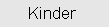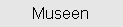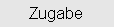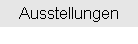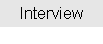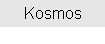Im Grunde seines Herzens fühlte er sich schon immer als Jazzer. Dabei ist er einer der bekanntesten Musiker Deutschlands. Was wie ein Parodoxon klingt, ist bei Klaus Doldinger gelebte Realität. Denn der 1936 in Berlin Geborene hat sein Leben der Musik gewidmet und damit über die Jahrzehnte ein Millionenpublikum erreicht. Als Saxophonist, Klarinettist, Komponist, Produzent, Bandleader und Funktionär der GEMA entwickelte Doldinger Soundtracks für Kino- und Fernsehfilme, schrieb Werbejingels, war Sideman großer internationaler Besetzungen und spiegelte mit seinen eigenen Projekten Live und im Studio auch immer den gelebten Zeitgeist wieder. Nun, kurz vor seinem 87. Geburtstag, ist die Biographie „Made in Germany – Mein Leben und meine Musik“ von ihm erschienen, man könnte auch sagen die Geschichte der Bundesrepublik – aus dem Blickwinkel eines Musikers.
Klaus' Sohn Nicolas Doldinger und der Journalist Torsten Groß erzählen auf über 300 Seiten von der relativ behüteten Kindheit in Berlin, Köln, Wien und Düsseldorf, den musikalischen Studien am Konservatorium, den ersten künstlerischen Versuchungen des Musikers nach der alles einschnürenden und jede Freiheit brachial unterdrückenden Nazizeit, über die ersten großen und anhaltenden Erfolge in der Musikwelt, bis hin zu den harten Corona-Entbehrungen unserer Tage, die dieses Buch letztendlich erst ermöglichten.
Schaut man sich Doldingers Discographie rückblickend etwas genauer und analytisch an, könnte man meinen, er präsentiere mit seiner Kunst den Soundtrack der Bundesrepublik. Denn mit den Feetwarmers schrieb und spielte(!) er tatsächlich Jazzgeschichte, mit seinem Quartett Modern Jazz, mit Passport, der Formation die noch heute besteht, entwickelte er über fünf Jahrzehnte hinweg den Fusion-Gedanken weiter, bei immer deutlicherer Einbeziehung ethnologischer Musikstile.
In Doldingers Band hat „uns Udo“ (Lindenberg) seine Karriere im Musikbuiseness als sehr talentierter Schlagzeuger begonnen; Siegfried Loch, einst Geschäftsführer von Liberty/United Artists Records, WEA Music und Warner Music Germany und heute Labeleigner von Act Music, war mit seinen Produktionen nicht allein zu Beginn der 1970er Jahre an dem Erfolg Doldingers maßgeblich beteiligt. Etliche Storys und Anekdoten stammen aus den Zeiten, als die Titelmelodie zum „Tatort“ oder „Liebling Kreuzberg“ und die Soundtracks zu „Die unendliche Geschichte“ und „Das Boot“ entstanden. Das alles zeigt: Doldinger war ein Workaholic, ein Kreativer, der immer an seiner Kunst arbeitete und natürlich im Laufe der Jahre auch das Glück hatte, sehr oft zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und die richtigen Menschen zu treffen. Das alles geht jedoch nur, wenn man selbst offen für neue Wege und Herausforderungen ist. Insofern ist sein Leben, ist seine Musik allein sein Verdienst. Der Jazz in Deutschland würde ohne Klaus Doldinger mit Sicherheit anders klingen.
Jörg Konrad
Klaus Doldinger
„Made in Germany – Mein Leben und meine Musik“
Piper