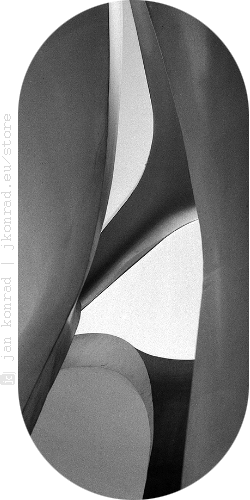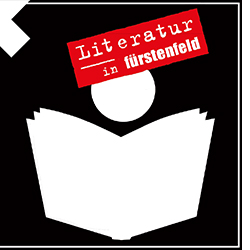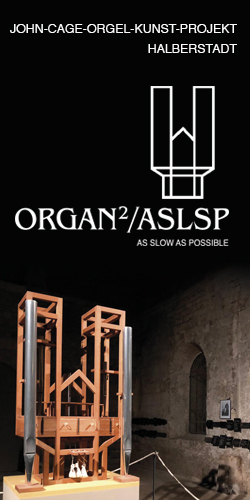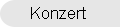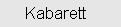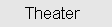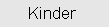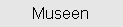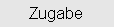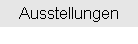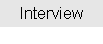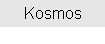Henrik Pontoppidan (1857-1943) war der 17. Nobelpreisträger und der erste Literat Dänemarks, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. Das Besondere: Er musste sie sich mit seinem Landsmann Karl Gjellerup teilen, der aber einen Großteil seiner Werke in deutscher Sprache schrieb und nicht zuletzt deshalb in seiner Heimat nie wirklich einflussreich war.
Henrik Pontoppidan hingegen war schon zu Lebzeiten in Dänemark „weltberühmt“ und gehört bis in die Gegenwart zu den bedeutendsten Autoren des Landes. Außerhalb Dänemarks ist er meist nur ausgewiesenen Skandinavien-Kennern ein Begriff.
Er begründete mit seinen literarischen Arbeiten den Naturalismus. Gleichzeitig galt er als ein ausgezeichneter Menschenversteher und -beobachter. So sind einerseits seine Landschaftsbeschreibungen von enormer Intensität und Poesie. Andererseits thematisiert er auf beeindruckende Weise die Stellung des Menschen sowohl im ländlichen, als auch im städtischen Umfeld. Aus dieser gelebten Gegensätzlichkeit schuf er seine bekanntesten Romane, wie „Das gelobte Land“, „Hans im Glück“ und „Das Totenreich“.
Dem Göttinger Wallstein Verlag, bei dem der vorliegende Band „Kaum ein Tag ohne Spektakel“ erschien, gelingt ein Wiedereinstieg in Pontoppidans Schaffen, nicht in dem er seine Romane neu auflegt, sondern die Vielseitigkeit des Autors zum Ausdruck bringt. Das Buch enthält Erzählungen und Geschichten, Kritiken, Kolumnen und Reportagen des Dänen – allesamt von Ulrich Sonnenberg neu übersetzt.
Der erste Teil des Bandes enthält insgesamt zwölf Erzählungen, in denen das Schicksal gegen die Moral kämpft, die Natur sich gegenüber der Moderne behauptet, die lokalen Gegebenheiten den Hoffnungen und Wünschen der Menschen manchmal unvereinbar gegenüberstehen. Manche dieser kurzen Texte klingen ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Doch im Grunde sind es genau die Themen, die bis in die Gegenwart die Menschen beschäftigen, die heute vielleicht in einem etwas anderen Licht betrachtet werden – aber letztendlich, oft schmerzhaft, um die Existenz in der Gesellschaft kreisen.
Zugleich zeigt Pontoppidan, trotz seiner konservativen Grundhaltung, deutlich eine gesellschaftskritische Distanz gegenüber gottesfürchtigen Lebensmaximen und strenggläubigen Wertesystemen, die er teilweise mit Ironie und leichtem Sarkasmus unterläuft.
Dass Henrik Pontoppidan jedoch nicht allein als literarischer Asket gesehen werden kann, machen seine Feuilletons und Kolumnen deutlich, die fast ausnahmslos als journalistische Arbeiten für Tageszeitungen entstanden sind. Besonders auffällig hier seine Reisebeschreibungen, wie eine Schiffsfahrt an den Polarkreis und vor allem die Reportage „Aus Berlin“. Hier verarbeitet der Autor einen Aufenthalt in der deutsche Hauptstadt im Jahr 1891. Es zeigt sich wieder seine enorme Beobachtungsgabe und in diesem Fall sein konkret kritischer Blick, sowohl auf die strenge Architektur des Zentrums von Berlin, als auch auf die nationalistischen Tendenzen innerhalb der Bevölkerung. Beides befremdet ihn.
„Kaum ein Tag ohne Spektakel“, das teilweise wie etwas aus der Zeit gefallen wirkt und dann wieder menschliche Schicksale mit derartiger Wucht beschreibt, als handele es sich um Literatur der Moderne, beeindruckt neben dem erzählerischen Können des Autors vor allem durch die Bandbreite der hier aufgegriffenen Themen. Insofern hat der Wallstein Verlag mit diesem Band auf weitere Werke des Dänen neugierig gemacht.
Jörg Konrad
Henrik Pontoppidan
„Kaum ein Tag ohne Spektakel“
Erzählungen und Feuilletons
Wallstein Verlag