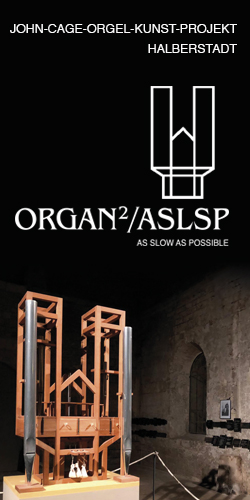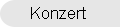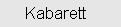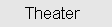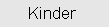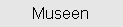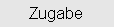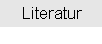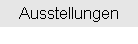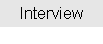Zurück zu den neuesten Artikeln...
Samstag 01.08.2020
83. Raumfahrt aus dem Homeoffice
Im Monat August werden die Tage nun deutlich kürzer und die abendliche Beobachtung beispielsweise des zenitnahen Sommerdreiecks gelingt schon deutlich gegen 21 Uhr.
Tief im Süden grüßen der recht helle Planet Jupiter und der deutlich lichtschwächere Nachbar Mars, der in diesem Artikel erneut im Fokus stehen wird. Strahlend hell zeigt sich hingegen Venus als Morgenstern am östlichen Himmel bereits gegen 4 Uhr früh.
Manchmal kann es passieren, dass aktuelle astronomische Ereignisse das Format des allmonatlichen Kosmos-Artikels sprengen, wenn nämlich jene Episoden beim Erscheinen zum Monatsanfang schon längst der Vergangenheit angehören. So geschehen im vergangenen Monat Juli, wo sich die Meldungen nur so überschlugen.
Beteiligt waren dabei die verschiedenartigsten wissenschaftlichen Raumsonden, die gewissermaßen im Auftrag der astronomischen Forschung unterwegs sind. Spitzenreiter bleiben dabei die nun schon vor fast 43 Jahren gestarteten Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2. Die als erfolgreichste Planetenexkursion aller Zeiten geltende Mission durchbrach mit Voyager 1 am 30. Juli eine weitere Schallmauer der Entfernungsmessung und das obwohl sie die Heliopause (Raum jenseits der Sonne, wo die Gravitationskraft unseres Zentralgestirns keinen Einfluss mehr auf einen Körper hat) bereits erreicht hat. Nun aber konnte sie von den inzwischen ebenfalls schon recht betagten und nur noch sporadisch als Ehrenamtler tätigen Ingenieuren in einer Entfernung von 150 Astronomischen Einheiten lokalisiert werden. Wie gigantisch die Entfernung des Methusalems der Raumfahrt ist, zeigt sich an der Tatsache, dass allein eine einzige Astronomische Einheit mit 150 Mill. Kilometern vermessen ist und die Entfernung von der Erde zur Sonne darstellt. Bis das Signal der mittlerweile 22,5 Milliarden Kilometer entfernten Tiefraumsonde im Kontrollzentrum des JPL in Pasadena erfasst werden konnte, dauerte es trotz der Lichtgeschwindigkeit von rund 300.000 km pro Sekunde fast 21 Stunden.
Gerade einmal 77 Mill. Kilometer war die Raumsonde Solar Orbiter von unserem Tagesgestirn entfernt, als sie sensationelle Fotos von der Sonnenoberfläche zur Erde sandte. So nah war noch nie ein Raumflugkörper der Sonnenkorona gekommen. Dabei ist dies nur der Anfang einer höchstinteressanten Mission, bei der die aus speziellen hochtemperaturbeständigen Materialien gefertigte Raumsonde sich der Sonne bis auf 42 Mill. Kilometer nähern soll. Die vom ESA-Raumflugzentrum in Darmstadt gesteuerte Sonde hatte dabei auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Zum ersten Mal in der Geschichte der unbemannten Raumfahrt wurde ein Raumfahrzeug größtenteils aus dem Homeoffice heraus an die Stelle der vorerst größten Annährung an die Sonne geleitet, um nun in eine Flugbahn gelenkt zu werden, die sie sowohl über den Nordpol als auch über den Südpol der Sonne führen wird: Gebiete, die noch nie ein Mensch zuvor in Augenschein nehmen konnte.
Die Raumsonde Wise ist eigentlich für die Untersuchung nah der Erde befindlicher Asteroiden ausgerichtet. So kann man getrost von einem Zufallstreffer sprechen, als das NASA-Weltraumteleskop am 27.März den Kometen C/2020 F3 aufspürte, der nun - der Tradition entsprechend - nach seinem Entdecker auch benannt wurde.
Zwar geriet der Schweifstern Neowise stark in das Interesse des Publikums, doch sein Aufsuchen am erst gegen 23 Uhr dunklen Nordhimmel gestaltete sich oft als schwierig. Immerhin ist er aber der erste Komet des 21.Jahrhunderts, der deutlich mit dem bloßem Auge sichtbar war. Diese atemberaubende Naturerscheinung konnte man zuletzt 1996 (Komet Hyakutake) bzw. 1995 (Komet Hale-Bopp) bestaunen. Das große C in seiner astronomischen Nomenklatur steht dabei für einen langperiodischen Umlauf um die Sonne. Erst in 6766 Jahren wird er sich der Sonne wieder nähern. Für wen wird er dann sichtbar werden ?
Mit ganz anderen Problemen haben hingegen die Raumsonden zu kämpfen, die das nur alle 26 Monate entstehende Startfenster zum Nachbarplaneten Mars nutzen wollen.
Nur für wenige Wochen ist es dann bei dem verhältnismäßig geringen Abstand zum Mars raumflugtechnisch sinnvoll, künstliche Himmelskörper mit finanziell vertretbarem Aufwand in die Richtung unseres Nachbarplaneten zu katapultieren.
Mit besonders großen Hoffnungen ging dabei die Raumsonde Hope (arabisch Al - Amal) an den Start. Es ist der erste von der Raumfahrtorganisation der Vereinigten Arabischen Emiraten in Auftrag gegebene Satellit und wurde in den USA gebaut. Leider hatte man dann auf ihrem japanischen Startplatz des Tanegashima Space Centers mit so schlechtem Wetter zu kämpfen, dass der Start erst am 20.Juli durchgeführt werden konnte. Das Abheben gelang mit der japanischen Trägerrakete H2A, welche zum 36.Mal hintereinander ohne Probleme ihre Nutzlastfunktion bewältigte. Zum 50.Geburtstag des Emirats Dubai soll dann der Wettersatellit im Februar 2021 in eine Umlaufbahn um den roten Planeten einschwenken und erstmals Daten über das Mars-Klima dokumentieren.
Die chinesische Mission Tianwen 1 („Suche nach der Wahrheit“) stellt mit ihrem Programm einer in die Umlaufbahn des Mars einschwenkenden Sonde, die dann ein Landemodul mit Bremsfallschirm absetzt, eine schon mehrfach angewandte Version der Annäherung an den Wüstenplaneten dar. Richtig interessant wird es, wenn das Modul in den entscheidenden letzten Minuten vor der Landung völlig autark arbeiten muss. Die Kommandos der Leitzentrale im Kosmodrom Wenchang kommen zu diesem Zeitpunkt bereits mit mehr als 20 Minuten Laufzeitverzögerung an und machen so kurzfristige Kurskorrekturen unmöglich. Sollte die Landung gelingen und sogar der kleine Rover noch Ausflüge auf dem Marsboden machen können, hätte sich das ehrgeizige Raumfahrtprogramm der Chinesen erfüllt. Am Morgen des 23.Juli gelang der planmäßige Start mit der Trägerrakete Langer Marsch 5.
Eine wesentlich größere Erfahrung bei der Umsetzung solcher Gesandtschaften zum kleinen Bruderplaneten der Erde hat die amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Ihre hochambitionierte Mission Perseverance („Beharrlichkeit“) soll nun erneut die Spitzenposition der USA auf dem Mars sichern, denn immerhin ist dies schon die vierte Generation der Kombination von Landemodulen und Rovern, welche die Amerikaner in der rötlichen Wüstenlandschaft absetzen wollen. Erstmals soll dann ein speziell für die dünne Marsatmosphäre konstruierter Helikopter über dem Landeort schweben. Auf die Bilder der hochauflösenden Spezialkamera kann man schon jetzt gespannt sein. Am 30.Juli ist Perseverance jedenfalls erfolgreich gestartet.
Die unrühmlichste Rolle bei diesem Wettlauf zum Mars spielt die europäische Raumfahrtbehörde ESA, denn auf den Start ihrer Mission EXO-Mars muss sie weiterhin verzichten. Obwohl dieses Projekt schon vor fast zwei Jahrzehnten aus der Taufe gehoben wurde und der eigentliche Start für 2018 geplant war, ließen die noch immer bestehenden technischen Probleme mit den Bremsfallschirmen einen Start nicht zu. Bleibt bei dem milliardenschweren Projekt der Europäer nur die Hoffnung auf das nächste Startfenster, welches sich Ende 2022 wieder öffnen wird.
Abschließend stellt sich die Frage, warum jede dieser einzelnen Raumfahrbehörden - anstelle einer weltumspannenden Zusammenarbeit wie auf der Internationalen Raumstation ISS - darauf setzt, das Fahrrad gewissermaßen neu zu erfinden. Hier kann auch der Autor nur achselzuckend die Augenbrauen heben.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
Mittwoch 01.07.2020
82. Frauen in der Astronomie
Der Monat Juli bringt uns keine gravierenden Änderungen der Beobachtungsmöglichkeiten. Zwar werden die Tage jetzt wieder kürzer und damit verlängert sich auch die für das Aufsuchen der Himmelsobjekte wichtige nächtliche Dunkelheit, doch noch ist dies kaum nachvollziehbar. Im Vergleich zwischen Monatsanfang und Monatsende verschieben sich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nur unmerklich um jeweils eine halbe Stunde, sodass die Tageslänge gerade einmal um eine ganze Stunde abnimmt. Das Sommerdreieck und die Planeten Jupiter, Mars und Saturn bestimmen die nächtliche Szenerie (Kosmos 81).
In der Geschichte der astronomischen Entdeckungen sind Frauen in den vergangenen Jahrhunderten äußerst rar gesät. Dies lag nicht nur an den fehlenden Frauenrechten, der sicherlich wissbegierigen jungen Damen, sondern auch an den rigiden Zulassungsbeschränkungen der jeweiligen astronomischen und physikalischen Fakultäten: Frauen im Hörsaal? Undenkbar! So waren es bis zur Öffnung der Studiengänge oftmals nur Zufälle oder verwandtschaftliche Beziehungen, die Frauen in den Berufsstand der Astronomin erhoben. Doch der Reihe nach: Schon der erste Exkurs einer Frau in die klassischen Wissenschaften endete mit einer grausigen Geschichte. Die um 355 in Alexandria geborene Hypatia war die erste Frau, der weitreichende Kenntnisse in der Astronomie und Mathematik nachgesagt wurden. Direkte Beweise dafür gibt es nicht, denn all ihre Schriften wurden vernichtet. Ihr scheinbarer Frevel bestand in den Unterrichtsvorträgen, die sie öffentlichen abhielt. Ein aufgestachelter Mob soll die einer nichtchristlichen Sekte angehörige Hypatia in eine Kirche verschleppt und dort getötet haben. Anschließend - so ist überliefert - habe man ihre Leiche zerstückelt und auch sonst alle Spuren ihres Daseins beseitigt.
Sophie Brahe und Caroline Herschel wurden hingegen in ihrer Zeit kaum bekannt, denn als Schwestern der großen Astronomen Tycho Brahe (siehe Kosmos 58) und Wilhelm Herschel (siehe Kosmos 41) fristeten sie zunächst eher das Dasein von helfenden Beobachterinnen oder minutiösen Protokollantinnen. Erst später konnten beide mit ersten wissenschaftlichen Arbeiten für Aufsehen sorgen.
Elisabetha Koopmann, die zweite Frau des Danziger Bierbrauers, Bürgermeisters und Astronomen Johannes Hevelius unterstützte die Arbeit ihres Mannes schon so weitreichend, dass sie durch intensives Beobachten in der Lage war, 1690, drei Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns, den von ihm angelegten Sternkatalog abzuschließen.Heute haben Frauen, deren Ehemänner ebenfalls bekannte Astronomen sind, ihre völlig eigenständigen Karrieren. So gilt Jana Tycha als anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Kometenkunde, sie hat mehrere Asteroiden entdeckt und leitet gemeinsam mit ihrem Mann Milos Tichy eine Sternwarte.
Eine weltbekannte Kometenentdeckerin ist Carolin Spellman, die gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Eugene Shoemaker den Kometen Shoemaker-Levy 9 entdeckte, dessen Kollision mit dem Planeten Jupiter im Juli 1994 als eines der Jahrhundertereignisse der Astronomie gefeiert wurde. Sie steht damit ganz in der Tradition von Maria Margaretha Kirch, die 1702 einen Kometen entdeckte und damit als erste Frau gilt, der dies gelang und von der wir dies nachweislich wissen.
Maria Cunitz wurde 1650 durch das über 500 seitige Werk Urania propitia bekannt. In diesem lateinischen Lehrbuch unterstützt sie als erste Frau das neue heliozentrische Weltbild des Nicolaus Copernicus und korrigiert darüber hinaus sogar einige Ungereimtheiten in dessen Schriften.
Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts waren Williamina Fleming und Henrietta Swan Leavitt tätig. Während Fleming ein System zur Klassifizierung von Sternen entwickelte und zahlreiche Gasnebel und Sterne entdeckte, gelang es Leavitt die periodische Leuchtkraftveränderung von Sternen in der Andromeda-Galaxis zu ermitteln. Die Entdeckung der sogenannten Cepheiden war letztlich der Grundstein dafür, dass die uns nächstliegende Galaxie mit einer Entfernung von mehr als einer Millionen Lichtjahren eingeordnet werden konnte. Dies weicht von dem heute gültigen Wert von 2,5 Millionen Lichtjahren zwar noch erheblich ab, aber für die damalige Zeit bedeutete dies einen gewaltigen Umbruch für die Entfernungsbestimmungen. Letztlich gab es sogar ein generelles Umdenken, denn bis dato galten alle Spiralnebel als Teil unserer eigenen Milchstraße. Henrietta Leavitt arbeitete dabei an der Seite von Edwin Powell Hubble (siehe Kosmos 30).
Ebenfalls in gemeinsamer Arbeit gelang es Jocelyn Bell Burnell mit Anthony Hewish im Jahre 1967 bei der Entdeckung des ersten Pulsars im Krebsnebel die Existenz von Neutronensternen nachzuweisen (siehe Kosmos 73).In der heutigen Zeit arbeiten viele Astronominnen an den verschiedensten Instituten und bekleiden zum Teil auch hochrangige Posten. So war die Kalifornierin Natalie Batalha maßgeblich an der Kepler-Mission beteiligt. Die britische Astrophysikerin Jo Dunkley ist eine der bekanntesten Kosmologinnen unserer Zeit und die österreichische Forscherin Lisa Kaltenegger ist Professorin an der Cornell-Universität in New York und leitet das dortige Carl-Sagan-Institute.
Und letztlich ist es auch Ann Druyan, die Witwe des großartigen Carl Sagan, die Erwähnung verdient. Wie ihr leider viel zu früh verstorbener Mann widmet sie sich unermüdlich der populärwissenschaftlichen Verbreitung der neusten Erkenntnisse der astronomischen Forschung unserer Tage.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
Montag 01.06.2020
81. Von Rotrückenspinnen und Sternenkannibalismus
Das Auffinden der Planeten im Monat Juni gestaltet sich schwierig. Zum einen haben wir kurze Nächte, da am 20.Juni die Sonne ihren mittäglichen Höchststand von 63 Grad über dem Horizont erreicht. Es ist der längste Tag des Jahres, an dem um 23.44 Uhr die Sommersonnenwende stattfindet.
Zum anderen hat sich die Venus, die über Monate mit ihrem Glanz den Abendhimmel überstrahlte, in eine Position zwischen Erde und Sonne begeben, sodass sie für uns fast den ganzen Monat nicht sichtbar bleibt. Am letzten Tag des Monats wird sie allerdings dann als heller Morgenstern im Osten zu sehen sein.
In den späten Nachtstunden wird der Jupiter zum auffälligsten Objekt. Allerdings ist eine freie Südsicht notwendig, um den recht flach über dem Horizont stehenden Planetenriesen zu beobachten.
Ähnliche Höhen erreichen Saturn und Mars. Auch sie sind in der zweiten Nachthälfte sichtbar, doch aufgrund der geringen Helligkeit gegenüber Jupiter viel schwerer aufzufinden.
Im Süden ist am abendlichen Himmel noch das wichtigste Sternbild des Frühjahrs zu erkennen: Mit seinem hellen Stern Regulus ist der Löwe die dominante Konstellation.
Mehr und mehr aber wird das Sommerdreieck mit den Sternen Wega (Leier), Deneb (Schwan) und Atair (Adler) auffällig werden. Schon in der Dämmerung kann man diese Sterne hoch in Zenitnähe in Augenschein nehmen.
Doppelsternsysteme sind im Weltraum keine so große Seltenheit. Mitten im Sommerdreieck liegt mit dem Stern Albireo das wohl eindrucksvollste Sternentandem, was man schon mit einem guten Feldstecher selbst begutachten kann.
Optisch ist zum Beispiel im Sternbild Großer Bär (in unserem Kulturkreis auch Großer Wagen genannt) mit bloßem Auge der sogenannte „Augenprüferstern“ recht gut erkennbar. Das auch als Reiterlein bekannte Sternenpaar Mizar und Alkor ist als Sternenpärchen der mittlere Stern der Deichsel. Der Legende nach hatten römische Centurionen die Aufgabe, in einer nächtlichen Prüfung den Deichselreiter zu erkennen.
Die kataklysmischen Veränderlichen sind allerdings die interessantesten unter den Doppelsternen, denn sie kommen sich so nah, dass sie auch in Kontakt miteinander treten können. Eine Entdeckung chinesischer Astronomen bestätigt die Tuchfühlung zweier sehr unterschiedlicher Sternexoten eindrucksvoll.
Beherrscher dieses Duos im Sternbild Herkules ist ein Neutronenstern, der sich als ein sogenannter Millisekunden-Pulsar entpuppt hat. Er dreht sich mit einer Periode von 0,00314 Sekunden, was wiederum umgerechnet heißt, dass er sich in einer einzigen Minute 19.000 mal um seine eigene Achse dreht. Das ihn die enormen Fliehkräfte dabei nicht zerreißen, liegt an dem mächtigen Magnetfeld an seinen Polen.
Der Begleiter ist ein sogenannter kleiner Hauptreihenstern, der noch knapp ein Fünftel der Masse unserer Sonne besitzt und den viel kleineren, aber massereicheren Pulsar bei einer Entfernung von 120.000km in nur fünf Stunden umrundet. Damit hat dieser kleine Stern einen Abstand, der einem Fünfzehntel des Abstandes unseres Planeten zur Sonne entspricht und seine Umlaufperiode ist gar 1250 mal schneller als die der Erde.
Was hat aber nun die australische Rotrückenspinne mit dem ungewöhnlichen Tanz des 26.000 Lichtjahre entferntem Doppelobjekts zu tun? Die Redback-Spider genannte Spinne hat ein ganz eigentümliches Paarungsritual, bei dem nach der Vereinigung das Weibchen das Männchen aussaugt. Auch im dem Redback-System M 92A im Kugelsternhaufen M 92 kommt es nun dazu, dass dem umrundenden Partner durch den nahen Pulsar über eine Materiebrücke ständig ein Plasmastrom heißer Gase abgesaugt wird und er damit ähnlich wie das Männchen der Rotrückenspinne diese grundverschiedene Bindung mit dem Leben bezahlen muss.
Noch allerdings wehrt sich der Partner, denn die Gasströme unterliegen großen Schwankungen, sodass man den Zeitpunkt für das Ende dieses ungleichen Kampfes nicht genau prognostizieren kann. Doch gewiss ist, dass dieser Sternenkannibalismus letztendlich zum endgültigen Verschwinden des Begleiters führen wird.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
Freitag 01.05.2020
80. Das kurzsichtige Teleskop
Nun erleben wir aufgrund der Sommerzeit schon Anfang Mai einen recht späten Sonnenuntergang und auch der morgendliche Himmel hellt sich sehr schnell auf: Die Bedingungen für die Beobachtung des Firmaments verschieben sich in die Nachtstunden. In der Morgendämmerung kann man in östlicher Richtung den abnehmenden Mond gleich drei Mal in einer besonderen Konstellation sehen. Am 12.5. steht er neben dem Jupiter, am 13.5. unterhalb des Saturns und am 15.5. ganz dicht am Mars. Allerdings ist das Auffinden recht schwierig, da die Himmelsobjekte gerade einmal 15 Grad über dem Horizont stehen und so unbedingt freie Sicht erforderlich ist. Bevor unser Abendstern Venus im Laufe des Monats deutlich an Höhe verliert und am Monatsende nur noch knapp nach Sonnenuntergang zu sehen ist, bietet sich uns am Monatsanfang in Richtung Süden gegen 22 Uhr letztmalig ein grandioser Anblick. Der obere Teil des Wintersechsecks mit den Zwillingen, dem Fuhrmann und dem Stier werden von der gleißend hellen Venus flankiert. Diese erreicht zum Monatsanfang ihre größte Annäherung zur Erde und ist so bis gegen Mitternacht sichtbar. Etwas weiter links vom hellen Abendstern erkennt man über dem Gürtel des Orion, dass der Stern Beteigeuze tatsächlich wieder heller wird. Im Gegensatz zu seinem schwachen Leuchten zum Jahreswechsel, ist er nun schon deutlich strahlender als der unmittelbare Nachbarstern Bellatrix, der Anfang Januar noch der glänzendere von beiden war (siehe Kosmos 2-20).
Dies zeigt deutlich, dass wir zeitversetzt (denn live kann man bei dem Abstand von 700 Lichtjahren nicht sagen) Zeugen des anhaltenden Todeskampfes des Schultersterns des Orion geworden sind. Der kurz vor seiner Selbstzerstörung stehende rote Riese mit ungefähr 1100 Sonnendurchmessern hat sich durch den Ausstoß riesiger Gasmassen gewissermaßen selbst unsichtbar gemacht. Hinter dieser Tarnkappe aus Wasserstoffwolken leuchtete er für wenige Monate nur wie ein normal leuchtender Stern. Nun aber diffundiert das Gas zunehmend und der Sterngigant erscheint wieder heller.
Das Hubble Space Telescope (HST) hat in den letzten 3 Jahrzehnten sehr oft solche Veränderungen bei den verschiedensten Himmelsobjekten fotografisch festhalten können.
Als allerdings vor genau 30 Jahren im Mai 1990 die ersten Bilder der Öffentlichkeit präsentiert wurden, fiel sogar dem Laien sofort auf, dass sie relativ unscharf waren.
Durch einen schier unvorstellbaren Fehler (man hatte die Inch- und Zentimetermaße nicht korrekt umgerechnet) war der Hauptspiegel des Teleskops um Bruchteile eines Millimeters falsch geschliffen. Schnell wurde klar: Das HST ist kurzsichtig und braucht eine Brille.
Die berühmt gewordenen Worte „The Trouble with Hubble is over“ kamen allerdings dem leitenden NASA-Chef Dan Goldin erst vier Jahre später erleichtert über die Lippen. Auf einer Pressekonferenz wurden die ersten Vorher-Nachher-Bilder präsentiert und die aufwendige Service-Mission der Space-Shuttle-Besatzung STS 61 konnte als überaus erfolgreich eingestuft werden. Während eines sechsstündigen Außeneinsatzes hatten die Astronauten der Endeavour dem Teleskop eine Art Kontaktlinse aufgesetzt und bei einer weiteren EVA (Extravehikulare Aktivität) wurde gleich noch eine neue Kamera installiert.
Mit diesen ersten, teilweise nun gestochen scharfen Bildern begann die eigentliche Erfolgsstory des Hubble-Weltraumteleskops. Eine ungeheuer vielfältige Welt mit zum Teil eindrucksvollen Bildern gehört zur Bildergalerie des bisher einzigen Teleskops, das ungestört aus der Atmosphäre der Erde im Orbit arbeiten kann. Auf der offiziellen Website http://heritage.stsci.edu/ kann man das ganze Spektrum der verschiedenartigsten Himmelsfotografien bewundern. Zu den wohl aufschlussreichsten Aufnahmen gehört die Fotoserie des veränderlichen Sterns V 838 Monocerotis.(1) Hier ist genau der Abstoß von Gashüllen zu erkennen, der aktuell auch bei Beteigeuze zu erwarten ist. Berühmt geworden ist auch das extremste Foto der Astronomie-Geschichte: Das Hubble Ultra Deep Field.(2) Hier konnten die entferntesten Galaxien des Universums in 13,8 Milliarden Lichtjahren Entfernung sichtbar gemacht werden.
Man hatte es geschafft, das Teleskop für sage und schreibe 16 Stunden auf einen winzig kleinen Teil des Kosmos zu fokussieren und anschließend die über 800 einzelnen Aufnahmen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Auch das unter dem Namen „The Pillars of Creation“ (Die Säulen der Schöpfung) bekannt gewordene Bild junger, sich aus ihrer Geburtswolke befreienden Protosterne sucht seines gleichen und ist so oft reproduziert und veröffentlicht worden, wie kein anderes Bild aus der Welt der Astronomie.(3)
Nun ist das HST 30 Jahre alt geworden und steht vor der Ablösung (siehe Kosmos 1-20). Dabei kommt die immer noch vorhandene Einsatzfähigkeit einem Wunder gleich, denn nach dem letzten überhaupt möglichen Service durch die STS 125-Mission vor wiederum genau 11 Jahren gab man dem Methusalem nur noch wenige Jahre. Nachdem fast 40 Stunden dauernden letztmaligem Austausch der Kamera hing das abzusehende Ende auch damit zusammen, dass einerseits das Space Shuttle 2011 außer Dienst gestellt wurde und im Museum landete, andererseits es seither kein Raumfahrzeug gibt, das sich dem Teleskop überhaupt nur nähern könnte.
Doch das 11,6 Tonnen schwere Instrument mit dem 2,4 Meter großen Hauptspiegel zeigte sich in der Folgezeit als äußerst robust. So könnte die zukünftige Lebensdauer eigentlich nur durch die permanente Geldknappheit der NASA oder das Lageregulierungssystem begrenzt werden. Für letzteres sind mindestens drei der sechs vorhandenen Gyroskope notwendig. Aber genau nur noch drei der Kreiselinstrumente funktionieren nach der extrem langen und so auch nicht konzipierten Lebensdauer von drei Jahrzehnten.
Sollte eines Tages die Nachricht kommen, dass der Kontakt zum Hubble Space Telescope aufgrund eines Gyroskop-Ausfalls unterbrochen ist, tut dies sicherlich der erfolgreichsten und wissenschaftlich einträglichsten Unternehmung der erdnahen Raumfahrt keinen Abbruch.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
Mittwoch 01.04.2020
79. Die magische 13
Im Monat April gilt es Abschied zu nehmen von den Wintersternen. Tief im Westen stehend, werden sie von den Frühlingssternbildern verdrängt. Dabei wird die Konstellation des Löwen zum Beherrscher des südlichen Abendhimmels. Viel deutlicher zeigt sich jedoch, dass die Venus im Südwesten alles überstrahlt. Sie hat nun ihre bestmögliche Sichtbarkeit erreicht, denn Ende des Monats nähert sie sich der größten scheinbaren Helligkeit mit -4,7 mag. Nach Sonne und Mond ist der Abendstern Venus dann das dritthellste Objekt am Himmel und bleibt mehr als vier Stunden über dem Horizont. Mit einem guten Fernglas lässt sich zum Monatsende sogar erkennen, dass sie, ähnlich wie der Mond, eine Sichelgestalt hat.
Die Planeten Mars, Jupiter und Saturn sind hingegen nur sehr schwer am östlichen Morgenhimmel zu entdecken, da sie kaum mehr als 10 Grad Höhe erreichen.
Im Monat April lohnt es sich einen Blick zurück auf die Mission Apollo 13 zu werfen: Ihr Ziel war es, neben der erfolgreichen Fortsetzung des Apollo-Programms, weiterhin die Erforschung des Mondes voranzutreiben. Wochenlang hatte sich das Astronauten-Team der dritten Mondlandemission um Kommandant Jim Lovell mit geologischen Studien befasst, um eine möglichst hohe Ausbeute in wissenschaftlicher Hinsicht zu erreichen.
Was am Ende blieb, war ein gewaltiger Schrecken, verbunden mit dem Wissen um die Verwundbarkeit einer Mission außerhalb des Erdorbits. Raumfahrtunternehmungen - egal welcher Art - müssen mit 100 prozentiger Sicherheit in allen Phasen geplant und durchgeführt werden, denn schon der kleinste Fehler kann katastrophale Auswirkungen haben.
Die Apollo 13 Mission nahm vor 50 Jahren am 11.April 1970 auf der Startbasis 39A des Kennedy Space Centers in Florida mit einem Bilderbuchstart ihren von der Öffentlichkeit mit nur mäßigem Interesse verfolgten Anfang. Dabei war die NASA bei der Auswahl des Startfensters keineswegs abergläubisch, denn es ist schon eine auffällige Anhäufung der Zahl 13 zu vermerken: Die 13. Mission sollte um 13.13 Uhr abheben und sich auf eine rund neuntägige Mondlandemission begeben. Dann aber sollte zwei Tage später am 13.April eine eher banale Explosion eines kleinen Sauerstofftanks eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes auslösen.
Eine Rückholaktion einer Crew, die sich bereits auf dem Weg zum Mond befindet, ist äußerst schwierig. Denn unterwegs mal eben kurz anhalten - wie unlängst in dem Science-Fiction Thriller „Ad Astra“ den staunenden Zuschauer vorgegaukelt wurde - ist für ein Raumschiff auf seinem Flug in der Kepler-Ellipse unmöglich. Um wieder zur Erde zu gelangen, muss für die Rückbeschleunigung der Raumkapsel ein TEI (Trans - Earth - Injection) durchgeführt werden. Für dieses Manöver hatte man durch die vorhergehenden Apollo-Missionen eigentlich ausreichende Erfahrungen.
Nur diesmal gestaltete sich der Rückstoß zur Erde weitaus schwieriger, denn lediglich ein Versuch war bei der Teilumrundung des Erdtrabanten mit Hilfe mit der Swingby-Technik möglich. Außerdem musste der entscheidende Impuls für den Rückflug zur Erde mit dem Triebwerk der Mondlandefähre erfolgen, die dafür wiederum nicht ausgelegt war. Doch dies gelang ebenso erfolgreich, wie auch die Lösung eines weiteren lebensgefährdenden Problems. Mit Hilfe eines improvisierten Filtersystems konnte der viel zu hohe CO 2 - Anteil in der Atemluft der Raumkapsel so angepasst werden, dass die Astronauten bis zuletzt mit genug Sauerstoff versorgt werden konnten.
Zwei Dinge seien noch vermerkt: Das Unglücksimage der Zahl 13 hat tatsächlich einen astronomischen Hintergrund. Aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen wurde im Mittelalter ein Jahr mit 13 Vollmonden vor allem in der Astrologie zum Unglücksjahr erklärt. Hintergrund ist die Zeit, die von Vollmond zu Vollmond verstreicht. Der siderische Monat mit genau 29,53 Tagen lässt zum Beispiel in der Kalenderrechnung die Möglichkeit zu, dass nach dem ersten Vollmond Anfang Januar Ende Dezember der 13.Vollmond folgt. Damit muss innerhalb dieses Kalenderjahres ein Monat zwei Vollmonde haben. Dieser zweite Vollmond wird auch Blue Moon genannt und hat sinnigerweise ein eher positives Image.
Übrigens hat Apollo 13 den Mond indirekt doch erreicht. Noch vor dem Unglück wurde die zweite Raketenoberstufe mit dem verbliebenen Treibstoff auf einen gezielten Kollisionskurs mit der Mondoberfläche gebracht. Dieses künstlich hervorgerufene Mondbeben wurde von den seismischen Detektoren erfasst, welche Armstrong und Aldrin während der Mission Apollo 11 installiert hatten. Der Aufprall des 14 Tonnen schweren Raketenteils hat einen bis heute sichtbaren Einschlagskrater hinterlassen.
Der Höllenritt selbst blieb für die Astronauten nicht ohne Folgen: Kaum hatten sie die Nachricht „Houston, wir haben ein Problem“ gesendet, schnellten die Einschaltquoten in ungeahnte Höhen.
Am Ende hatten sie den Mondboden zwar nicht betreten, doch nach der erfolgreichen Landung im Pazifik wurden sie wie Nationalhelden gefeiert. Eine wochenlange Quarantäne blieb ihnen erspart. Allerdings waren sie durch Kälte und Dehydrierung soweit geschwächt, dass ihnen eigentlich deutlich anzusehen war, dass sie nicht zum Feiern aufgelegt waren: Ein Aufenthalt im Krankenhaus war unumgänglich. Jack Swigert, der als Ersatzmann in die Crew gekommen war, hatte sogar lange Zeit mit einer schmerzhaften Harnwegsinfektion zu kämpfen. Die Ironie der Geschichte ist allerdings, dass Ken Mattingly, der wegen eines Röteln-Kontakts aus dem Team geflogen war, diese Infektionskrankheit nie bekam, dafür aber als Verbindungssprecher (CapCom) bei Mission Control zum eigentlichen Helden der Rückkehrmission wurde. Genau zwei Jahre später nahm er an der erfolgreichen Mission Apollo 16 teil und erfreut sich heute mit 84 Jahren bester Gesundheit.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
Sonntag 01.03.2020
78. Von Jazzgitarristen und Kometenjägern
In den letzten Wintertagen bis zur ersten Tagundnachtgleiche am 20.März d.J. präsentiert sich noch immer das grandiose Wintersechseck in südlicher Richtung. Mitten in dieser größten Konstellation des nördlichen Sternhimmels kämpft der immer leuchtschwächer werdende Stern Beteigeuze den aussichtslosen Kampf gegen seine Selbstzerstörung (siehe Kosmos 2-20). Die Fachwelt hat sich dabei nun festgelegt: Keine 10.000 Jahre wird der Stern mehr existieren.
Unser Abendstern Venus hat hingegen in den vergangenen Wochen eine deutliche Erhöhung seiner Leuchtkraft offenbart. Allerdings leuchtet sie nicht selbst, sondern reflektiert das Sonnenlicht. Da sich der Blickwinkel deutlicher zum positiven verändert, ist der Nachbarplanet in der frühen Abenddämmerung hoch im Südwesten als hellstes Himmelsobjekt erkennbar.
Zur Monatsmitte ist die Beobachtung eines morgendlichen Stelldicheins der Planeten Jupiter, Mars und Saturn lohnenswert. Allerdings erreicht die Planetenparade nur eine geringe Höhe von 10 Grad über dem Horizont. Am besten findet man das Triumvirat, wenn sich in den Morgenstunden des 17.3. und 18.3. die abnehmende Mondsichel hinzugesellt.
Am Ende des Monats ist dann ein Zusammentreffen der Neumondsichel mit den Plejaden in der Nähe des Sterns Aldebaran im Stier zu sehen. Diese besondere Konstellation wurde schon vor 3300 Jahren auf der berühmten Himmelsscheibe von Nebra verewigt. Diesmal wird das Zusammentreffen sogar noch von der Venus flankiert.
Schon in der Vergangenheit haben einige Amateurastronomen durch ihre teils sensationellen Entdeckungen die Theorien der ältesten Wissenschaft unserer Erde in verschiedener Art und Weise zum Teil erheblich bereichert, aber auch gehörig durcheinandergewirbelt. So war Jan Hevel, genannt Hevelius, aus Danzig durch das Bierbrauen und das Heiraten der reichen Nachbarstochter zu so großem Wohlstand gekommen. Um einen idealen Blick zu den Sternen zu haben, ließ er seine eigene Sternwarte auf den Dächern seiner drei nebeneinanderstehenden Bürgerhäuser aufbauen. Die von ihm in lateinischer Sprache verfassten Beschreibungen der Himmelskonstellationen wurden ebenso bekannt wie seine Mondkartografie. Dabei wurde Hevelius sogar von seinem König Jan Sobieski unterstützt. Als Dank widmete er ihm das Sternbild Schild.
Fast vergessen ist hingegen der Dessauer Apotheker Samuel Heinrich Schwabe. Ihm gelang es nach jahrzehntelangen Beobachtungen erstmals die Schwankungen der Sonnenflecken in einer wiederkehrenden Periodizität zu beschreiben: Im Mittel treten alle 11,2 Jahre die Störungen der Photosphäre extrem gehäuft auf. Der Schwabe-Zyklus findet heute als Maßstab für die Sonnenaktivität in der ganzen Welt seine Anwendung. Übrigens wurde der anhaltische Astronom 1868 ebenso wie fast genau 200 Jahre zuvor Hevelius in die Royal Astronomical Society gewählt.
Für viele Freizeit-Astronomen ist die Jagd nach bisher unbekannten Kometen zur Erfüllung ihrer Träume geworden, denn hier kann man noch im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht berühmt werden. Es war in den nächtlichen Stunden des 23. Juli 1995, als Alan Hale und Thomas Bopp fast gleichzeitig, aber völlig unabhängig voneinander den später nach ihnen benannten großen Kometen Hale-Bopp entdeckten. Ein echter Zufallstreffer, denn der Komet kommt der Sonne nur alle 2533 Jahre so nah. Konnten die beiden Amerikaner noch recht gut mit ihrer plötzlichen Berühmtheit umgehen, gelang dies dem Japaner Yuji Hyakutake keinesfalls. Der bescheiden und zurückgezogen lebende Amateurastronom aus der Präfektur Nagasaki hatten den großen Kometen des Jahres 1996 mit einem Großfernglas entdeckt, der - so ist die Bestimmung der Internationalen Astronomischen Union - ebenfalls nach ihm benannt wurde. Der Ruhm war aber dem zu diesem Zeitpunkt arbeitslosen Kometenentdecker eher unangenehm und sein ohnehin schon schlechter Gesundheitszustand verschlechterte sich mehr und mehr. Nur sechs Jahre nach der großartigen Entdeckung verstarb er 51jährig an Herz-Kreislauf-Versagen.
Zwei Hobbyastronomen der heutigen Zeit sind vor Kurzem zu bescheidenem Ruhm gekommen. Der Werdegang von Allan Lawrence ist dabei noch recht gut nachvollziehbar: Er hatte eine ebenso erfolgreiche wie lukrative Karriere als Wirtschaftsberater hinter sich, als er im Alter von 65 Jahren begann Astrophysik an der Iowa State University zu studieren. Inzwischen hat der nunmehr 77jährige aus Wisconsin stammende Lawrence seinen Master in der Tasche und überraschte die Fachwelt unlängst mit einem Artikel in der angesehenen Zeitschrift „Astrophysical Journal“, in der er von der Entdeckung eines doppelten Kerns in der 30 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxis NGC 4490 berichtete. Man kann hier mit Fug und Recht behaupten, dass der „Nachwuchsforscher“ die Experten auf die richtige Spur brachte, denn nun lässt sich die Entstehungsgeschichte dieser fernen Sternenwelt eindeutig damit beschreiben, dass vor einigen Milliarden Jahren zwei Galaxien miteinander verschmolzen.
Was hat nun aber ein Jazzmusiker mit der Meteoritenforschung zu tun ? Vor wenigen Jahren noch tourte der norwegische Jazzgitarrist Jon Larsen mit seiner Band „Hot Club de Norvege“ durch die Lande. Während einer Teestunde beobachtete er durch Zufall, wie sich aus dem Nichts ein winzig kleines Steinkörnchen auf seiner Serviette niederließ. Die Idee, dass dies ein Mikrometeorit sein könnte, verfestigte sich schnell, denn es war absolut windstill zu dieser nachmittäglichen Zeit. Mit beständiger Beharrlichkeit und unbändiger Energie, den typischen Eigenschaften eines Jazzmusikers, stürzte er sich in die Arbeit. Dabei ist die vielzitierte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gegen die Sisyphusarbeit der Kleinstmeteoritensuche allerdings eher ein Kinderspiel. Nach über einem Jahrzehnt des Hobbyforschens gipfelt die Suche nun in einem vielbestaunten Bildband, der die Wichtigkeit der Aufarbeitung selbst kleinster interplanetarischer Teilchen farbenprächtig dokumentiert
Beiden Hobbyforscher gilt eine große Hochachtung, denn es ist ein nicht gerade einfacher Weg sich in der etablierte Fachforschung einen anerkannten Namen zu machen.
Klaus Huch, Planetarium Halberstadt
Autor: Siehe Artikel
KultKomplott versteht sich als ein unabhängiges, kulturelle Strömungen aufnehmendes und reflektierendes Portal.